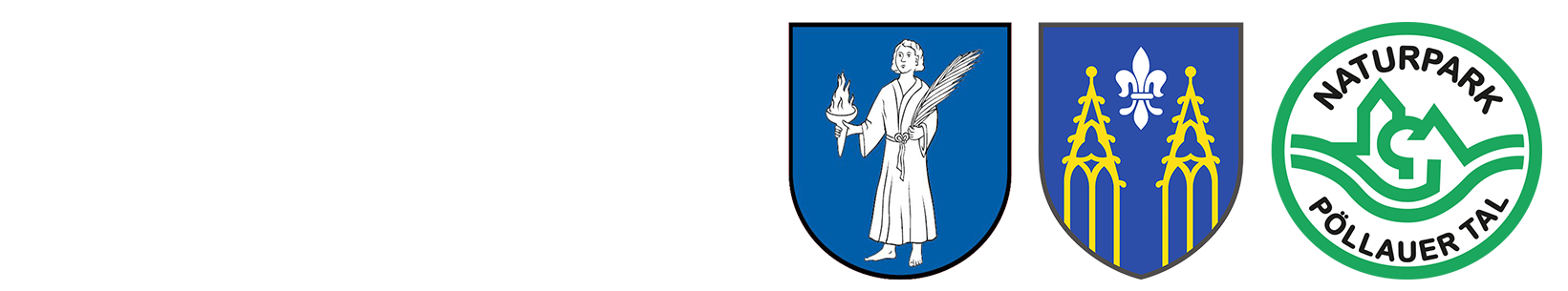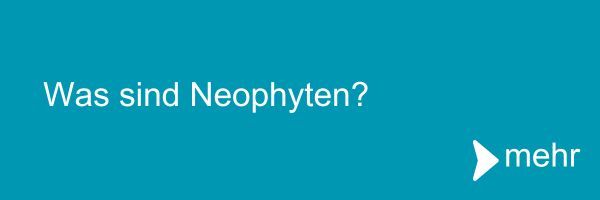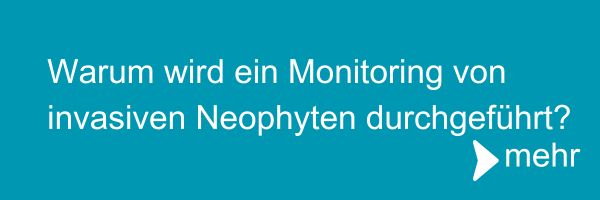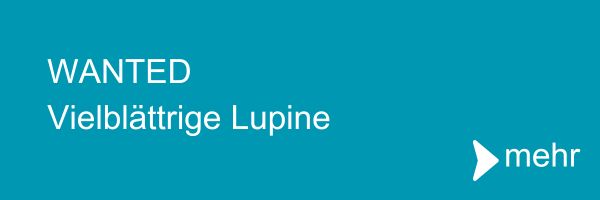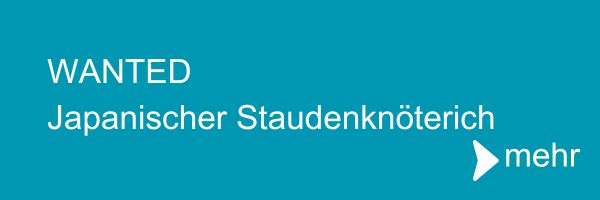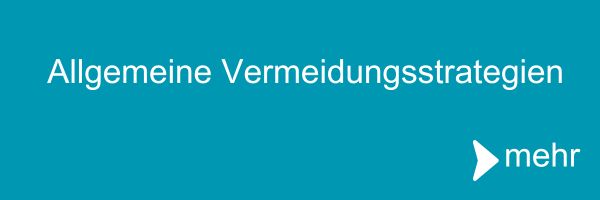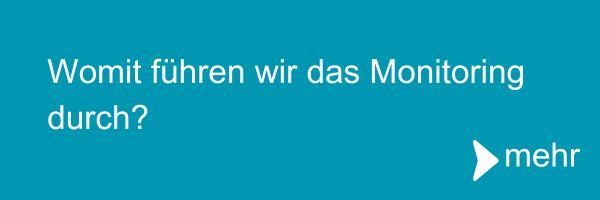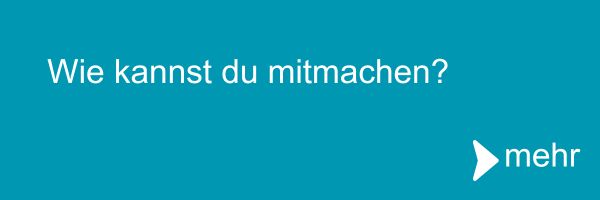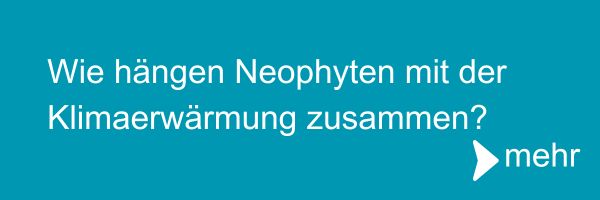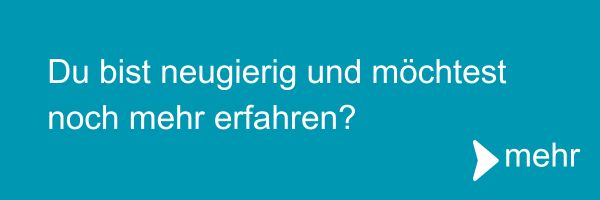Was sind Neophyten?
Neophyten sind Pflanzenarten, die absichtlich oder unabsichtlich in ein Gebiet eingeführt wurden, in dem sie ursprünglich nicht heimisch waren. Der Begriff stammt aus dem Griechischen („neo“ = neu, „phyton“ = Pflanze) und bezeichnet Pflanzen, die sich nach 1492 (dem Jahr der ‚Entdeckung‘ Amerikas durch Kolumbus) in einem neuen Gebiet etabliert haben.
Was sind invasive Neophyten?
Invasive Neophyten sind nicht-heimische Pflanzenarten, die sich in einem neuen Gebiet stark ausbreiten und negative ökologische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Auswirkungen haben. Sie wurden absichtlich oder unbeabsichtigt eingeführt und verdrängen oft heimische Pflanzen und Tiere. Merkmale invasiver Neophyten sind:
-Schnelles Wachstum und hohe Vermehrungsrate
-Fehlende natürliche Feinde oder Konkurrenz
-Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umweltbedingungen
-Bildung dichter Bestände, die heimische Arten verdrängen
Was bedeutet Monitoring?
Monitoring bezeichnet die systematische Beobachtung und Erfassung von Prozessen, Entwicklungen und Daten über einen längeren Zeitraum hinweg.
Warum wird ein Monitoring von invasiven Neophyten durchgeführt?
Beim Monitoring invasiver Neophyten werden ihre Ausbreitung, Auswirkungen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen überwacht.
Mit welchen invasiven Neophyten führen wir ein Monitoring im Naturpark Pöllauer Tal durch?
Drüsiges Springkraut
Das Drüsige Springkraut stammt ursprünglich aus dem Himalayagebiet und wurde im 19. Jahrhundert als Zier- und Bienenpflanze nach Europa eingeführt. Heute breitet sie sich massiv aus und verdrängt heimische Arten.
Problematik
-Verdrängt heimische Pflanzen, da es dichte Bestände bildet
– Problematisch aufgrund der extrem schnellen Vermehrung, denn eine Pflanze produziert bis zu 4.000 Samen
– Verbreitet sich entlang von Flussufern, Straßenrändern und Wiesen
– Fördert Bodenerosion an Flussufern, weil es nach dem Absterben im Herbst (=einjährige Pflanze) kahle Flächen hinterlässt
Kontrolle und Bekämpfung
– Frühzeitiges Entfernen (vor der Samenbildung)
– Manuelles Ausreißen bei Einzelpflanzen oder Mähen bei Dominanzbeständen mehrmals pro Jahr notwendig
-Trocknen des Pflanzmaterials auf einer Unterlage, damit erneutes Austreiben vermieden wird
-Die Bekämpfung dauert mindestens 3 Jahre bis eine merkliche Reduktion bei Dominanzbeständen sichtbar wird.

Einjähriges Berufkraut
Das Kanadische Berufkraut stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde im 17. Jahrhundert nach Europa eingeschleppt. Heute ist es extrem weit verbreitet und ist ökologisch problematisch, da es viele heimische Pflanzen verdrängt.
Problematik
– Stark invasive Pflanze
– Besonders resistent gegen Trockenheit & Herbizide
– Wächst schnell auf Brachflächen, Äckern, Straßenrändern und Bahngleisen
– Landwirtschaftliches Problem, da es sich massiv in Getreidefeldern ausbreiten kann
Kontrolle und Bekämpfung
– Manuelles Ausreißen vor der Samenreife
– Mulchen oder tiefes Umgraben verhindert erneutes Wachstum
– Frühzeitiges Mähen reduziert die Samenbildung

Vielblättrige Lupine
Die Vielblättrige Lupine stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde im 19. Jahrhundert als Zierpflanze und Bodenverbesserer nach Europa eingeführt. Inzwischen gilt sie in vielen Regionen, wie auch dem Naturpark Pöllauer Tal, als invasive Art, die heimische Pflanzen verdrängt und Ökosysteme beeinträchtigt.
Problematik
-Verdrängt heimische Pflanzen durch Stickstoffanreicherung im Boden
-Bildet dichte Bestände, die Artenvielfalt verringern
-Breitet sich rasant über Samen aus (bis zu 200 Samen pro Pflanze)
-Gefährdet mageren Lebensraum (wie z. B. artenreiche Wiesen & Moore)
-Giftig für viele Tiere, da sie Alkaloide enthält
Kontrolle und Bekämpfung
-Mähen vor der Samenbildung, um Ausbreitung zu verhindern
-Ausreißen, Ausgraben oder Ausstechen

Japanischer Staudenknöterich
Der Japanische Staudenknöterich stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde im 19. Jahrhundert als Zierpflanze und Böschungsbefestigung nach Europa eingeführt. Heute gilt er als eine der problematischsten invasiven Pflanzen, da er sich extrem schnell verbreitet, heimische Arten verdrängt und Infrastruktur zerstört.
Problematik
-Extrem schnelle Ausbreitung (Wurzeln können bis zu 3 Meter tief und 7 Meter weit wachsen)
-Schädigt Infrastruktur, da Rhizome durch Straßen, Mauern und Beton wachsen
-Verdrängt aufgrund der extrem dichten Bestände heimische Pflanzen
-Bekämpfung ist extrem schwer, da selbst kleine Wurzelreste wieder austreiben
Kontrolle und Bekämpfung (Quelle: Naturschutzbrief 244.pdf)
-Ausbaggern des Bodens (wenn möglich)
-Beweidung mit Schafen, Ziegen, Pferden oder Rindern
-Bei etablierten Pflanzen, muss vor der Beweidung eine Mahd erfolgen

Beifußblättriges Traubenkraut
Das Beifußblättrige Traubenkraut, auch Ambrosia oder Ragweed genannt, stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde mit Vogelfutterimporten nach Europa eingeschleppt. Besonders problematisch ist sie, weil ihre Pollen starke Allergien auslösen können.
Problematik
-Extrem allergieauslösender Pollen
-Die lange Blütezeit von August bis Oktober verlängert die Allergiesaison
-Rasante Ausbreitung über Samen und landwirtschaftliche Flächen
-Verdrängt heimische Pflanzen durch starkes Wachstum
Kontrolle und Bekämpfung
-WICHTIG! Unbedingt auf ausreichende Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Masken etc.) beim Entfernen der Pflanze achten!
-WICHTIG! Die Pflanze muss im Plastikbeutel im Restmüll entsorgt werden. Bitte nicht verbrennen oder auf den Kompost werfen.
-Pflanzenteile (inkl. Wurzel) vor der Blüte im Frühling entfernen
-Häufiges Mähen um Samenbildung zu verhindern
-Funde bitte bei www.ragweedfinder.at melden

WICHTIG! Allgemeine Vermeidungsstrategien
-Entferntes Pflanzenmaterial mit Samenanlagen nicht vor Ort lagern und nur in geschlossenen Systemen abtransportieren um Verbreitung zu vermeiden.
-Bei Beständen invasiver Neophyten an Gewässern sollte die Bekämpfung immer am Oberlauf beginnen, um eine erneute Ausbreitung flussabwärts zu vermeiden.
-Gärtner sollten darauf verzichten, Grünschnitt im Wald zu entsorgen, da sich Pflanzen wie Bambus oder Kirschlorbeer dort unkontrolliert ausbreiten können.
-Waldbewirtschafter können die Verbreitung von Neophyten verhindern, indem sie Maschinen und Schuhe vor dem Betreten neophytenfreier Gebiete reinigen, da auch der Mensch als Vektor für die Ausbreitung dient.
(Quelle: 20240318 Bekämpfung von Neophyten – YouTube)
Womit führen wir das Monitoring durch?
Wir nutzen die App „iNaturalist“.
iNaturalist ist eine App und Online-Plattform, die es Menschen ermöglicht, Pflanzen, Tiere und Pilze zu identifizieren und zu dokumentieren. Sie kombiniert künstliche Intelligenz (KI) mit einer Community von Wissenschaftlern und Naturfreund:innen, um Beobachtungen zu bestimmen und zur Forschung beizutragen.
Wie kannst du mitmachen?
Es gibt viele Möglichkeiten beim Monitoring invasiver Neophyten im Naturpark Pöllauer Tal mitzumachen:
- iNaturalist nutzen und selbst das Vorkommen der invasiven Neophyten in deiner Nähe aufzeichnen
- Teilnahme am Workshop für Gärtner:innen „Wenn die Pflanzen strawanzen“ am 10.05.2025 und dein Wissen dabei noch mehr vertiefen
- Mitwandern bei den Neophyten-Monitoring-Wanderungen
Workshop „Wenn die Pflanzen strawanzen“
Viele invasive Neophyten wurden ursprünglich als Zierpflanzen für Gärten eingeführt, bevor sie sich „ausgewildert“ haben. Beispiele dafür sind etwa der Japanische Staudenknöterich (wurde als Zierpflanze eingeführt), das Drüsige Springkraut (wurde als bienenfreundliche Gartenpflanze eingeführt) oder die Kanadische Goldrute (wurde als attraktive Gartenstaude eingeführt) und viele mehr. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, beschäftigen wir uns im Workshop damit, wie man Neophyten im Hausgarten erkennen und nachhaltig entfernen kann. Gemeinsam tauschen wir Erfahrungen aus und erhalten wertvolle Tipps für eine naturnahe Gartengestaltung mit heimischen, ökologisch unbedenklichen Pflanzen.
Wann: Samstag, 10.05.2025, 10:00-11:30 Uhr
Wo: Alpenkräutergarten Käfer
Kosten: Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung mit Anmeldung unter: klimaschutz@naturpark-poellauertal.at
Referent: DI Stefan Käfer

Nachbericht:
DI Stefan Käfer führte durch seinen auf 1.000 m Seehöhe gelegenen Alpenkräutergarten im Naturpark Pöllauer Tal. Im Rahmen des spannenden Workshops erhielten die Teilnehmer:innen wertvolle Einblicke in das Thema invasive Neophyten, deren Auswirkungen auf heimische Ökosysteme sowie mögliche Bekämpfungsstrategien im eigenen Garten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der bewussten Auswahl ökologisch wertvoller und/oder heimischer Pflanzen für den Hausgarten und die Hecke.




Neophyten-Monitoring-Wanderungen
Wir wandern gemeinsam an drei Terminen und halten fest, welche invasiven Neophyten wir dabei sehen.
Naturpark Erlebnisrundweg
Wann: verschoben wegen Schlechtwetter, neuer Termin wird noch bekannt gegeben
Treffpunkt: Schlosspark Pöllau Parkplatz
Gehzeit: 1,5-2 Stunden
Kosten: Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung mit Anmeldung unter: klimaschutz@naturpark-poellauertal.at
Rundwanderung: Pöllauberg-Masenberg-Schwaig-Pöllauberg
Wann: verschoben wegen Schlechtwetter, neuer Termin wird noch bekannt gegeben
Treffpunkt: Naturparkarena, Pöllauberg
Gehzeit: 5 h
Kosten: Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung mit Anmeldung unter: klimaschutz@naturpark-poellauertal.at
Klimazukunft-Weg
Wann: Freitag, 06.06.2025, 17:00
Treffpunkt: Schlosspark Pöllau Parkplatz
Gehzeit: 2,5 h
Kosten: Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung mit Anmeldung unter: klimaschutz@naturpark-poellauertal.at

Wie hängen Neophyten mit der Klimaerwärmung zusammen?
Durch den Temperaturanstieg und zunehmende Trockenheit entstehen ideale Bedingungen für Neophyten aus wärmeren Regionen, während heimische Arten durch die anhaltenden trockenen und heißen Witterungsperioden geschwächt werden.
Auch extreme Wettereignisse begünstigen die Ausbreitung von Neophyten, da sie offene Flächen schaffen und die Verbreitung von Samen und Sprossen fördern.
Du bist neugierig und möchtest noch mehr erfahren? Hier haben wir eine Linksammlung zusammengestellt:
Übersichtstabelle der wichtigsten Problempflanzen der Steiermark der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht
Neobiota des Land Steiermark
Praxis-Tipps zur Ragweed Bekämpfung des Projektes Joint Ambrosia Action des Land Burgenlad in Zusammenarbeit mit der BOKU Wien, MedUni Wien und der LK Burgenland
Neophyten in der Forstwirtschaft, Vortrag beim Waldmontag des Waldverbandes
Aliens aus dem Garten der Österreichischen Bundesforst in Kooperation mit dem Umweltbundesamt und Biosphärenpark Wiener Wald Management
Es wird keine Haftung oder Verantwortung für die Inhalte der Links übernommen.
Was passiert in den Gemeinden?
Die Gemeinde Pöllauberg und der Naturpark Pöllauer Tal entschieden sich auch am Workshop für Gemeindemitarbeiter:innen des Umwelt-Bildungs-Zentrum in Pöllauberg teilzunehmen. Dr. Eva Lenhard schulte einen Vormittag lang zum Thema Neobiota in der Steiermark.






Das Projekt „Klimawandel-Anpassungsmodellregion Naturpark Pöllauer Tal“ wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ durchgeführt.